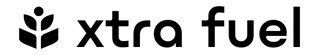Schilddrüsenüberfunktion (Hyperthyreose) verstehen
Eine Schilddrüsenüberfunktion liegt vor, wenn die Schilddrüse zu viele Hormone produziert. Diese Hormone – Thyroxin (T4) und Trijodthyronin (T3) – beschleunigen den Stoffwechsel und beeinflussen Herz, Verdauung, Nerven und viele weitere Körperfunktionen. Bei einer Überfunktion laufen diese Prozesse ständig auf Hochtouren, was zu vielfältigen Beschwerden führt. Morbus Basedow (Basedow’sche Krankheit) – eine Autoimmunerkrankung – ist weltweit die häufigste Ursache der Hyperthyreose. Daneben können auch funktionelle Autonomien der Schilddrüse (sogenannte „heiße Knoten“) oder vorübergehend Schilddrüsenentzündungen eine Überfunktion auslösen. Im Gegensatz zur Schilddrüsenunterfunktion, bei der zu wenig Hormone vorhanden sind, bedeutet eine Überfunktion also einen Überschuss an Schilddrüsenhormonen im Körper.
Wer ist betroffen? Insgesamt tritt eine Hyperthyreose bei etwa 1–2% der Bevölkerung auf (Frauen sind deutlich häufiger betroffen als Männer)(1). Oft beginnt die Erkrankung zwischen dem 30. und 50. Lebensjahr, kann aber grundsätzlich in jedem Alter auftreten. Genetische Veranlagung und Autoimmunprozesse spielen eine große Rolle – beim Morbus Basedow als Hauptursache handelt es sich um eine fehlgeleitete Abwehrreaktion, bei der Antikörper die Schilddrüse zur Überproduktion stimulieren. Auch länger bestehender Jodmangel kann indirekt beitragen: In jodarmen Regionen mit Kropfbildung neigen autonom gewordene Schilddrüsenareale bei plötzlicher hoher Jodzufuhr zu einer Überfunktion (sogenannte jodinduzierte Hyperthyreose). Umgekehrt kann in seltenen Fällen ein extremer Jodüberschuss (z.B. durch sehr hochdosierte Algenpräparate oder jodhaltige Kontrastmittel) bei empfindlichen Personen eine Hyperthyreose auslösen – man spricht vom Jod-Basedow-Effekt(2,3,4,5,6).
Warum ist eine Überfunktion problematisch? Ein Überschuss an Schilddrüsenhormonen belastet den gesamten Organismus. Unbehandelt kann eine schwere Hyperthyreose zu gefährlichen Komplikationen wie Herzrhythmusstörungen (Vorhofflimmern), Knochenschwund (Osteoporose) und sogar einer lebensbedrohlichen thyreotoxischen Krise führen. Selbst milde Formen (subklinische Hyperthyreose, d.h. noch normale T3/T4-Werte bei bereits unterdrücktem TSH) erhöhen das Risiko für Knochenbrüche um etwa 30%(8,9). Es ist daher wichtig, eine Schilddrüsenüberfunktion frühzeitig zu erkennen und gezielt zu behandeln. Die Standardtherapie besteht – je nach Ursache – aus Thyreostatika (Medikamenten, die die Hormonproduktion bremsen) und gegebenenfalls einer Radiojodtherapie oder operativen Entfernung von Schilddrüsengewebe. Diese Behandlungen können die Überfunktion meist effektiv kontrollieren, allerdings treten dabei teils Nebenwirkungen auf (z.B. können Antithyreotika die weißen Blutkörperchen drastisch reduzieren oder die Leber belasten; nach Radiojod oder Operation resultiert häufig eine Unterfunktion). Umso wichtiger ist es, begleitend durch Lebensstil und Ernährung den Körper zu unterstützen. Zwar ersetzt eine Ernährungsanpassung nicht die ärztliche Therapie, aber sie kann helfen, Symptome zu lindern und langfristig die Gesundheit der Schilddrüse zu fördern – natürlich immer in Absprache mit dem Arzt.
Symptome einer Schilddrüsenüberfunktion
Eine Überfunktion kann sich durch eine Reihe charakteristischer Beschwerden bemerkbar machen, weil der Stoffwechsel gewissermaßen „auf Turbodrehzahl“ läuft. Typische Symptome sind unter anderem:
- Herzrasen und Bluthochdruck: Betroffene leiden häufig unter beschleunigtem Herzschlag und Herzklopfen bis hin zu Herzrhythmusstörungen. Ruhepulswerte über 100 Schläge/Minute sind keine Seltenheit. Auf Dauer kann dies das Herz stark beanspruchen.
- Nervosität und innere Unruhe: Viele Patienten fühlen sich innerlich getrieben, angespannt und reizbar. Häufig treten Schlafstörungen auf – sei es Einschlafschwierigkeiten oder unruhiges, kurzes Schlafen mit häufigem Aufwachen.
- Starkes Schwitzen und Hitzeempfindlichkeit: Die Überfunktion erhöht die Körpertemperatur, was zu Wärmeunverträglichkeit führt. Patienten schwitzen vermehrt, haben feuchte, warme Haut und fühlen sich in warmen Umgebungen schnell unwohl.
- Unerklärlicher Gewichtsverlust bei gutem Appetit: Durch den gesteigerten Grundumsatz verbrennt der Körper mehr Kalorien. Viele Betroffene nehmen trotz normaler oder sogar erhöhter Nahrungsaufnahme ab. Gleichzeitig können Heißhungerattacken und vermehrter Durst auftreten.
- Zittern und Muskelschwäche: Ein feinschlägiges Zittern der Hände ist typisch. Zudem kommt es zu Muskelschwäche und schnellem Ermüden – selbst Alltagsbelastungen fallen plötzlich schwerer.
- Psychische Veränderungen: Neben Reizbarkeit können auch Angstgefühle, Panikattacken oder depressive Verstimmungen vorkommen. Manche berichten zudem von Konzentrationsproblemen und einem Gefühl von „Gedankenflucht“.
- Häufigerer Stuhlgang oder Durchfall: Die Verdauung läuft beschleunigt. Dies äußert sich in vermehrtem Stuhlgang, bisweilen auch Durchfall und Bauchschmerzen.
- Haut, Haare und Nägel: Die Haut ist oft dünn, warm und feucht. Diffuser Haarausfall und brüchige Nägel können auftreten, da der schnelle Stoffwechsel die Nährstoffversorgung von Haut, Haarwurzeln und Nagelbett beeinträchtigt.
- Menstruationsstörungen und Potenzprobleme: Bei Frauen kann es zu Zyklusstörungen kommen – beispielsweise unregelmäßige oder ausbleibende Monatsblutungen. Die Fruchtbarkeit kann vorübergehend reduziert sein. Männer bemerken unter Umständen eine verringerte Potenz.
- Augensymptome (bei Morbus Basedow): Etwa die Hälfte der Basedow-Patienten entwickelt Augenprobleme, bekannt als endokrine Orbitopathie. Kennzeichen sind hervortretende Augen (Exophthalmus), geschwollene Lider, Druckgefühl hinter den Augen, vermehrter Tränenfluss, Lichtempfindlichkeit und Doppelbilder. In schweren Fällen kann die Sehfähigkeit beeinträchtigt sein. Hinweis: Diese Augenveränderungen treten fast ausschließlich bei der Autoimmunform Morbus Basedow auf.
Nicht jeder Betroffene weist alle genannten Symptome auf – Ausprägung und Kombination können von Person zu Person stark variieren. Insbesondere ältere Patienten zeigen mitunter weniger typische Anzeichen (man spricht von einer „apathetischen“ Hyperthyreose), z.B. eher allgemeine Abgeschlagenheit oder Gewichtsabnahme ohne auffällige Herzsymptome. Wichtig ist: Wenn Symptome wie anhaltendes Herzrasen, unerklärlicher Gewichtsverlust oder die beschriebenen Augensymptome auftreten, sollte dringend eine ärztliche Abklärung erfolgen. Mit einer einfachen Blutuntersuchung (TSH sowie freie T3- und T4-Werte) lässt sich feststellen, ob eine Schilddrüsenüberfunktion vorliegt. Gegebenenfalls schließt sich eine Bestimmung von Antikörpern (TRAK bei Verdacht auf Basedow) sowie eine Ultraschall- oder Szintigraphie-Untersuchung an, um Ursache und Ausmaß einzugrenzen. Gut zu wissen: Durch konsequente Behandlung können sich die meisten Symptome einer Hyperthyreose innerhalb von Wochen bis wenigen Monaten deutlich bessern. Bis die Hormonwerte wieder im Normalbereich sind, können vom Arzt vorübergehend Beta-Blocker gegen Herzrasen, Zittern und Unruhe verschrieben werden. Parallel dazu lohnt es sich, über Ernährung und Lebensweise Einfluss zu nehmen – wie das genau geht, erfährst Du im nächsten Abschnitt.
Ernährung bei Schilddrüsenüberfunktion: Mit der richtigen Kost den Körper unterstützen
Eine gesunde, angepasste Ernährung kann bei Schilddrüsenüberfunktion auf mehreren Ebenen helfen. Zum einen braucht der Körper ausreichend Energie und Nährstoffe, um dem gesteigerten Verbrauch gerecht zu werden und Gewichtsverlust sowie Nährstoffdefizite vorzubeugen. Zum anderen lassen sich durch gezielte Lebensmittelwahl bestimmte Symptome abmildern – zum Beispiel indem man sehr jodreiche Kost einschränkt, um die überschießende Hormonproduktion nicht noch zusätzlich anzuheizen. Zudem können auch Mikronährstoffe (wie Selen) sowie Vitamine und sekundäre Pflanzenstoffe mit antioxidativer Wirkung die Schilddrüse und das Immunsystem entlasten. Hinweis: Eine Übersichtsarbeit betont, dass neben moderater Jodzufuhr und guter Selen-Versorgung nur wenige Ernährungsfaktoren bei Schilddrüsenkrankheiten klar belegt sind(11,12). Dennoch kann eine durchdachte Lebensmittelauswahl dazu beitragen, Symptome zu lindern und die allgemeine Gesundheit zu stärken. Hier erfährst Du, auf welche Punkte Du achten solltest:
Jodzufuhr mäßigen (keine extreme Jod-Karenz, aber Übermaß vermeiden)
Jod ist der Grundbaustein der Schilddrüsenhormone T3 und T4. Normalerweise gilt: Ohne genügend Jod keine ausreichende Hormonproduktion – daher spielt bei einer Unterfunktion oft Jodmangel eine Rolle. Bei der Überfunktion ist jedoch das Gegenteil das Problem: Hier produziert die Schilddrüse trotz normaler Jodversorgung zu viele Hormone. Eine hohe Jodzufuhr kann diese Überproduktion unter Umständen noch weiter ankurbeln, insbesondere wenn autonome Knoten in der Schilddrüse vorliegen(13,14). Deshalb wird bei Morbus Basedow und Schilddrüsenautonomien häufig geraten, exzessive Jodmengen zu vermeiden.
Konkrete Tipps:
- Meeresalgen und Seetang: Kelp, Nori, Wakame & Co. enthalten extrem viel Jod und sollten bei Hyperthyreose gemieden werden. Manche Nahrungsergänzungsmittel („Schilddrüsen-Kapseln“) setzen ebenfalls auf Algenextrakte mit hohem Jodgehalt – solche Präparate sind für Überfunktions-Patienten nicht geeignet.
- Seefisch in Maßen: Auch Seefisch und Meeresfrüchte liefern Jod, aber in moderaten Mengen. Du musst nicht gänzlich auf Fisch verzichten – ein bis zwei Portionen Meeresfisch pro Woche sind in Ordnung. Bevorzuge dabei Sorten mit mittlerem Jodgehalt (z.B. Lachs, Hering) und iss keine großen Mengen Seetang-haltiges Sushi.
- Jodiertes Speisesalz: In Deutschland ist Speisesalz oft mit Jod angereichert (ca. 15–25 µg pro Gramm Salz). Du musst darauf nicht strikt verzichten – diese übliche Jodierung trägt zur Grundversorgung bei. Eine extrem salzhaltige Kost (wäre ohnehin ungesund) sollte man aber meiden. Wenn Du häufig außer Haus isst: Fertiggerichte, Kantinenessen und Fast Food enthalten meist reichlich jodiertes Salz – hier also bewusst den Konsum begrenzen.
- Milchprodukte und Eier: Auch Milch, Milchprodukte und Eier liefern moderat Jod (abhängig vom Jodgehalt des Tierfutters). Sie können weiterhin Teil Deiner Ernährung sein – ein völliger Verzicht auf Jod ist nicht das Ziel, sondern nur die Vermeidung von Überdosierungen.
Wichtig: Eine vollständige Jodkarenz ist nicht sinnvoll, denn der Körper benötigt etwa 150–200 µg Jod täglich für viele wichtige Stoffwechselfunktionen. Es geht also um Mäßigung, nicht um kompletten Verzicht. Insbesondere wenn eine Radiojodtherapie geplant ist, wird oft vorab vorübergehend jodarm gegessen, um die Behandlung effektiver zu machen – solche Diäten immer nur nach ärztlicher Anweisung durchführen. Generell gilt: Die normale ausgewogene Kost in Deutschland liefert (durch Jodsalz) ungefähr 180–200 µg Jod pro Tag, was in Ordnung ist. Erst zusätzliche hochjodhaltige Präparate oder extreme Algenzufuhr würden problematisch. Behalte daher Deine Nahrungsergänzungsmittel im Blick und sprich im Zweifel mit dem Arzt.
Ausreichend Kalorien, hochwertiges Eiweiß und hohe Nährstoffdichte
Durch den beschleunigten Stoffwechsel verbraucht Dein Körper in der Überfunktionsphase mehr Kalorien als gewöhnlich – eine Art „Hypermetabolismus“. Dein Grundumsatz kann um 10–20% erhöht sein, in schweren Fällen noch mehr. Gleichzeitig werden vermehrt körpereigene Proteine abgebaut, was zu Muskelschwund führen kann. Um dem entgegenzuwirken:
- Energiezufuhr steigern: Achte darauf, genügend Kalorien zu Dir zu nehmen, damit Dein Körper nicht an die eigenen Reserven (Muskelprotein, Fettdepots) gehen muss. Iss regelmäßig und greife zu energie- und nährstoffdichten Lebensmitteln: z.B. Nüsse, Avocado, Pflanzenöle, Vollkornprodukte. Wenn Du ungewollt stark abnimmst, können zusätzliche Snacks und Zwischenmahlzeiten sinnvoll sein (z.B. ein Smoothie aus Haferflocken, Banane, Nussmus und Pflanzenmilch als kalorienreiches Getränk).
- Hochwertiges Eiweiß einbauen: Um Muskelsubstanz zu erhalten, braucht der Körper ausreichend Protein. Empfohlen werden ca. 1,2–1,5 g Eiweiß pro kg Körpergewicht in solchen „Stressphasen“ (für 70 kg also ~85–105 g Eiweiß/Tag). Gute Quellen sind mageres Fleisch, Fisch, Eier, Milchprodukte, Hülsenfrüchte, Tofu und Nüsse. Verteile die Proteinzufuhr über den Tag (jede Hauptmahlzeit etwa 20–30 g Eiweiß); das unterstützt auch die Muskelregeneration. Sollte die normale Ernährung nicht ausreichen, können z.B. Proteinshakes oder ein Quark mit Nüssen als Snack helfen.
- Nährstoffdichte erhöhen: Wähle Lebensmittel mit hoher Mikronährstoff-Dichte, um Vitamin- und Mineralstoffdefiziten vorzubeugen. Frisches Gemüse, Obst, Vollkorn, Hülsenfrüchte, Nüsse und Samen liefern viele Vitamine, Mineralien und Antioxidantien auf relativ geringe Kalorien. Gerade weil der Körper bei Hyperthyreose mehr Vitamine und Mineralstoffe verbraucht oder verliert, ist eine bunte, vollwertige Kost wichtig. Beispielsweise steigt durch die gesteigerte Stoffwechselaktivität der Bedarf an B-Vitaminen und Magnesium. Auch verliert man durch das viele Schwitzen mehr Elektrolyte (v.a. Kalium und Magnesium) – greife daher reichlich zu grünem Blattgemüse, Bohnen, Nüssen und Vollkornprodukten (Magnesiumquellen) sowie zu Obst (Kaliumquelle).
Ein appetitlicher Weg, viele Nährstoffe aufzunehmen, sind Grüne Smoothies oder Shakes. Zum Beispiel liefert ein Smoothie aus Spinat, Mango, Haferflocken, Mandelmus und Joghurt in einem Getränk gleichzeitig Proteine, Kalorien, Magnesium, B-Vitamine, Calcium und Antioxidantien. So kannst Du auch an Tagen mit wenig Appetit viel Gutes in Dich aufnehmen.
Wichtige Mikronährstoffe: Selen, Zink, Vitamin D, Calcium & Co.
Bestimmte Spurenelemente und Vitamine spielen bei der Schilddrüsenfunktion und bei den Folgen einer Hyperthyreose eine besondere Rolle. Hier die wichtigsten im Überblick:
- Selen: Dieses Spurenelement ist essentiell für die Schilddrüse. Selen ist Bestandteil von Enzymen (Deiodasen), die Schilddrüsenhormone in ihre aktive Form umwandeln, sowie von antioxidativen Enzymen, die die Schilddrüse vor oxidativem Stress schützen. Ein guter Selenstatus ist mit einer stabileren Schilddrüsenfunktion assoziiert. Offiziell ist folgender Health-Claim in der EU zugelassen: „Selen trägt zu einer normalen Schilddrüsenfunktion bei.“ Praktisch alle Hyperthyreose-Patienten sollten also auf ausreichend Selen achten – insbesondere bei Morbus Basedow mit seinen Autoimmunprozessen. Studien zeigen, dass eine Selen-Supplementierung begleitend zur Therapie freie Schilddrüsenhormone messbar senken und den TSH-Spiegel anheben kann(15). In einer Meta-Analyse über 10 Studien fand man nach 6 Monaten Selen-Einnahme einen positiven Effekt: fT4 und fT3 waren niedriger, TSH höher als in der Placebo-Gruppe(16,17). Allerdings war dieser Effekt nach 9 Monaten nicht mehr signifikant – möglicherweise ist also nur ein zeitlich begrenzter Nutzen vorhanden. Selen gilt in richtiger Dosierung als sicher; bei Basedow werden oft ca. 200 µg/Tag für einige Monate eingesetzt. Natürliche Selenquellen sind Paranüsse (schon eine einzige Paranuss enthält ca. 50–70 µg), Fisch, Fleisch, Vollkorngetreide und Eier. Hinweis: Falls Du Selen als Ergänzung einnehmen möchtest, sprich dies mit Deinem Arzt ab – er kann Deinen Selenspiegel bestimmen. Überdosierungen (>300–400 µg täglich) sollten vermieden werden.
- Zink: Zink ist an unzähligen Stoffwechselprozessen beteiligt – unter anderem am Immunsystem und an der Geweberegeneration. Eine Schilddrüsenüberfunktion beschleunigt gewisse Zinkverluste (z.B. über den Urin)(19), weshalb viele Hyperthyreose-Patienten niedrigere Zinkwerte aufweisen als Gesunde(20). Zinkmangel kann Müdigkeit, Haarausfall und Hautprobleme verstärken – alles Symptome, die bei Hyperthyreose ohnehin auftreten können. Ausreichend Zink zuzuführen kann daher helfen, Immunsystem sowie Haut und Haar zu unterstützen (für Zink existiert der offizielle EU-Claim „trägt zu einem normalen Stoffwechsel und zu einer normalen Funktion des Immunsystems bei“). Gute Zinkquellen sind z.B. Haferflocken, Kürbiskerne, Hülsenfrüchte, Rindfleisch, Hartkäse und Cashewkerne. Ein leicht erhöhter Bedarf (etwa 15 mg statt 10 mg täglich) kann durch gezielte Ernährung meist gedeckt werden. Bei starkem Mangel kann vorübergehend ein Zinkpräparat sinnvoll sein – lass das im Zweifelsfall im Blut prüfen.
- Vitamin D und Calcium: Eine Überfunktion beschleunigt den Knochenabbau. Es wird vermehrt Kalzium aus den Knochen freigesetzt, was das Risiko für Osteoporose steigert. Dem muss man unbedingt entgegenwirken. Vitamin D ist nötig, damit Kalzium aus der Nahrung aufgenommen wird und in die Knochen eingebaut werden kann. Calcium selbst ist der Hauptbaustoff der Knochenmatrix. Viele Hyperthyreose-Patienten haben Vitamin-D-Mangel; insbesondere bei Morbus Basedow zeigen Studien deutlich niedrigere Vitamin-D-Spiegel als bei gesunden Kontrollpersonen(21,22). Ausreichend Vitamin D (ggf. als Supplement in Absprache mit dem Arzt, z.B. 1000–2000 IE/Tag in sonnenarmen Monaten) und eine calciumreiche Ernährung sind daher essenziell. Calciumreiche Lebensmittel sind vor allem Milchprodukte (Quark, Käse, Joghurt), aber auch einige Gemüsesorten (Brokkoli, Grünkohl), Nüsse/Samen (Mandeln, Sesam) und calciumangereicherte Pflanzendrinks. Ziel sollte sein, etwa 1000–1200 mg Calcium pro Tag aufzunehmen. Tipp: Ein Glas Milch, eine Scheibe Käse und ein Becher Joghurt liefern zusammen schon rund 700–800 mg Calcium. Lass ggf. Deinen Vitamin-D-Spiegel vom Arzt prüfen (25-OH-D-Wert) – bei starkem Mangel wird oft eine hochdosierte Anfangstherapie verordnet, um den Speicher zügig zu füllen. Fazit: Gute Vitamin-D- und Calciumversorgung schützt die Knochen während der belastenden Überfunktionsphase und sollte nicht vernachlässigt werden.
- Magnesium und B-Vitamine: Diese beiden stehen exemplarisch für Nährstoffe, die bei Schilddrüsenüberfunktion vermehrt benötigt werden. Magnesium ist wichtig für die Nerven- und Muskelfunktion – es hilft, das übererregte Nervensystem zu beruhigen und die Muskulatur (inklusive Herzmuskel) zu entspannen. Zudem geht durch den schnelleren Stoffwechsel und häufiges Schwitzen mehr Magnesium verloren. Ein Mangel kann sich in Wadenkrämpfen, Nervosität und Herzstolpern äußern. Greife daher zu magnesiumreichen Lebensmitteln: Vollkorn, Haferflocken, Nüsse, Samen, Hülsenfrüchte, Bananen und dunkles Blattgemüse. Ggf. kann abends ein Magnesiumcitrat-Präparat (300–400 mg) helfen, nächtliche Krämpfe vorzubeugen – viele Patienten berichten, dass es auch den Schlaf verbessert. B-Vitamine (v.a. B1, B6, B12) sind essentiell für den Energiestoffwechsel und die Nervenfunktion. Ein erhöhter Stoffwechsel bedeutet einen erhöhten Bedarf an B-Vitaminen. Besonders Vitamin B1 (Thiamin) wird bei einem „Turbo-Stoffwechsel“ stärker verbraucht (Mangel kann zu Müdigkeit und Appetitlosigkeit beitragen), und Vitamin B6 ist nötig für die Bildung von Neurotransmittern (wichtig für Stimmung und Schlaf). Achte auf eine gute Versorgung mit Vollkornprodukten, Hülsenfrüchten, Fleisch, Fisch, Eiern und grünem Gemüse. Eine moderate Vitamin-B-Komplex-Supplementierung kann erwogen werden, insbesondere wenn Deine Ernährung einseitig ist.
- Antioxidantien: Überschüssige Schilddrüsenhormone führen zu oxidativem Stress – es entstehen mehr freie Radikale, die Zellen schädigen können(23,24). Antioxidantien sind daher wertvoll, um Zellschäden entgegenzuwirken. Dazu zählen Vitamin C, Vitamin E, Beta-Carotin, Selen (s.o.), Zink (s.o.) und sekundäre Pflanzenstoffe (Polyphenole, Flavonoide etc.). Eine Ernährung reich an buntem Gemüse und Obst liefert viele dieser Antioxidantien. Beispielsweise sind Beeren, Kirschen, Zitrusfrüchte, Paprika, grüne Blattgemüse und Tomaten hervorragende Lieferanten von Vitamin C und Polyphenolen. Auch Gewürze und Kräuter enthalten hochkonzentriert antioxidative Stoffe – z.B. Kurkuma (Curcumin) oder mediterrane Kräuter wie Oregano, Rosmarin und Basilikum. Verwende diese nicht nur aus geschmacklichen, sondern auch aus gesundheitlichen Gründen großzügig. Tipp: Eine Tasse grüner Tee am Tag liefert Catechine (Polyphenole) mit antioxidativer Wirkung – allerdings enthält grüner Tee auch Koffein, daher nur in Maßen genießen (siehe weiter unten zu Koffein).
Neben den genannten Nährstoffen sollten natürlich alle essentiellen Vitamine und Mineralstoffe ausreichend zugeführt werden. Beispielsweise kann ein Mangel an Eisen die ohnehin bestehende Müdigkeit verstärken (und den Haarverlust). Gerade Frauen mit Hyperthyreose haben öfter niedrige Ferritin-Werte. Achte auf Dein Blutbild und sprich mit dem Arzt, ob eine vorübergehende Eisensupplementierung nötig ist. Generell gilt aber: Keine hochdosierten Nahrungsergänzungen ohne Rücksprache – vieles lässt sich durch eine kluge Ernährung regeln.
Heilkräuter und natürliche Helfer bei Hyperthyreose
In der Phytotherapie und Naturheilkunde gibt es einige Kräuter und Pflanzenstoffe, die traditionell zur Beruhigung einer überaktiven Schilddrüse eingesetzt werden. Wissenschaftlich ist dieses Feld noch nicht umfassend erforscht, doch erste Studien liefern interessante Hinweise. Hier ein paar natürliche Helfer, die begleitend Erleichterung verschaffen können (Hinweis: Noch nicht von der EFSA bestätigt; weitere Studien erforderlich.):
- Zitronenmelisse (Melissa officinalis): Zitronenmelisse wird seit langem eine beruhigende Wirkung auf Nerven und (laut Überlieferung) auch auf die Schilddrüse zugeschrieben. Tatsächlich deuten Tierversuche darauf hin, dass Melissen-Extrakt die Schilddrüsenaktivität drosseln kann. In einer Studie an hyperthyreoten Ratten führte Melisse-Extrakt dazu, dass die erhöhten T3- und T4-Spiegel signifikant sanken und der zuvor unterdrückte TSH-Spiegel wieder anstieg(25) – ein Hinweis darauf, dass Melisse die Überfunktion modulieren kann. Auch die durch Hyperthyreose ausgelösten Leberschäden und Entzündungsmarker verbesserten sich im Tiermodell unter Melisse(26). Diese Ergebnisse müssen zwar noch am Menschen bestätigt werden, stützen aber die traditionelle Anwendung. In der Praxis nutzen viele Basedow-Patienten Melissentee oder Melissen-Tinktur, um Unruhezustände zu mildern. Als Tee kannst Du 2–3 Tassen täglich aus Melissenblättern trinken (Ziehzeit etwa 10 Minuten). Melisse gilt als gut verträglich. Beachte: Hochdosierte Melissen-Extrakte sind kein Ersatz für vom Arzt verordnete Thyreostatika, können aber unterstützend wirken – sprich eine Einnahme von konzentrierten Präparaten am besten mit Deinem Therapeuten ab. (Noch nicht von der EFSA bestätigt; weitere Studien erforderlich.)
- Wolfstrapp (Lycopus europaeus) und Bugleweed (Lycopus virginicus): Wolfstrapp-Kraut genießt den Ruf eines natürlichen „Schilddrüsen-Bremsers“. Es soll die Freisetzung von Schilddrüsenhormonen hemmen, insbesondere bei milderen Überfunktionen. Tatsächlich gibt es kleinere klinische Untersuchungen dazu: In einer deutschen Pilotstudie erhielten Patienten mit leichter Hyperthyreose über 3 Monate einen Lycopus-Extrakt. Ergebnis: Symptome wie Herzklopfen gingen zurück und die Schilddrüsenwerte stabilisierten sich tendenziell(27,28). Insbesondere verbesserte sich ein objektiver Laborparameter – die vermehrte Ausscheidung von T4 über die Nieren – unter Wolfstrapp, was auf eine Entlastung hinweist(29). Die Autoren folgerten, dass Lycopus bei leichten Formen positive Effekte zeigt und gut vertragen wird(30). Auch ein Tierversuch stützt die Wirkung: Ein Lycopus-Extrakt reduzierte bei Ratten mit induzierter Schilddrüsenüberfunktion die typischen Herz-Kreislauf-Symptome deutlich(31,32). In Nordamerika wird Bugleweed-Tee traditionell eingesetzt, um Herzrasen und Schwitzen zu lindern. Wichtig für Anwender: Wolfstrapp sollte nicht bei bestehendem Kinderwunsch, in der Schwangerschaft oder Stillzeit verwendet werden, da es den Hormonhaushalt beeinflussen kann. Außerdem kann Wolfstrapp die Wirkung von Schilddrüsenmedikamenten verstärken – setze es daher nur nach Rücksprache ein, wenn Du Medikamente nimmst. Als Tee wird häufig 1 TL getrocknetes Kraut pro Tasse mit kochendem Wasser übergossen (10 Minuten ziehen lassen; max. 2–3 Tassen/Tag). Fertige Tinkturen bitte nach Herstellerangaben dosieren. Disclaimer: Zur Sicherheit der Langzeitanwendung liegen noch begrenzte Daten vor; nutze Wolfstrapp am besten kurweise und beobachte die Wirkung. (Noch nicht von der EFSA bestätigt; weitere Studien erforderlich.)
- Baldrian, Passionsblume & Lavendel: Diese Pflanzen beeinflussen zwar nicht die Schilddrüse direkt, können aber typische Beschwerden lindern. Baldrianwurzel, Passionsblumenkraut und Lavendelblüten wirken beruhigend und schlaffördernd – hilfreich bei Nervosität, Herzklopfen und Schlafstörungen im Rahmen einer Hyperthyreose. Eine abendliche Tasse Baldrian- oder Lavendeltee kann helfen, besser abzuschalten. Auch als Fertigpräparate (Tabletten oder Tropfen) sind diese Kräuter erhältlich. Sie machen nicht abhängig und sind eine natürliche Alternative zu synthetischen Beruhigungsmitteln. Viele Betroffene bauen ein pflanzliches Beruhigungsmittel in ihre Abendroutine ein, um trotz „hochgetunten“ Stoffwechsels zur Ruhe zu finden. (Da diese Heilpflanzen nicht direkt auf die Hormonproduktion wirken, sind hier keine EFSA-Claim-Probleme zu erwarten; ihre entspannende Wirkung ist traditionell bekannt und anerkannt.)
- Ashwagandha (Withania somnifera): Dieses Adaptogen-Kraut wird zwar häufig bei Schilddrüsenproblemen genannt, jedoch meist im Zusammenhang mit Unterfunktion – es gibt Hinweise darauf, dass Ashwagandha die Schilddrüsenhormonproduktion leicht steigern kann, was bei Hypothyreose nützlich sein könnte. Bei Überfunktion ist jedoch Vorsicht geboten: Manche Quellen behaupten, Ashwagandha wirke „ausgleichend“, doch wissenschaftliche Belege für einen Vorteil bei Hyperthyreose fehlen. Im Gegenteil könnte Ashwagandha die Schilddrüsenaktivität eher noch erhöhen. Daher ist von Ashwagandha bei bestehender Überfunktion abzuraten (außer ein erfahrener Therapeut empfiehlt es im Einzelfall gezielt). Konzentriere Dich lieber auf die beruhigenden Kräuter oben.
Zusammengefasst: Es gibt einige pflanzliche Helfer, die begleitend Symptome lindern oder die Schilddrüsenaktivität leicht beeinflussen könnten. Denke aber daran: Natürliche Kräuter ersetzen keine schulmedizinische Therapie – insbesondere bei mittelschwerer oder schwerer Hyperthyreose. Nutze sie als Ergänzung, um Dein Wohlbefinden zu steigern, und informiere Deinen Arzt über alle pflanzlichen Mittel, die Du einnimmst (um Wechselwirkungen zu vermeiden).
Lebensmittel und Genussmittel: Was man meiden oder einschränken sollte
Einige Nahrungs- und Genussmittel können die Beschwerden einer Schilddrüsenüberfunktion verstärken. Auf folgende Dinge solltest Du besonders achten:
- Koffein und stimulierende Getränke: Kaffee, schwarzer/grüner Tee, Energy-Drinks und Cola enthalten Koffein (bzw. Tein) – das regt das Herz-Kreislauf-System an und kann Symptome wie Herzrasen, Zittern, Nervosität und Schlaflosigkeit verschlimmern. Wenn Du merkst, dass Dich Koffein zusätzlich „aufdreht“, reduziere den Konsum deutlich oder setze koffeinhaltige Getränke vorübergehend ganz ab. Steige auf entkoffeinierte Varianten oder Kräutertees (Melisse, Kamille, Pfefferminze) um. Auch Schokolade enthält etwas Koffein sowie Theobromin, das stimulierend wirkt – genieße sie daher in Maßen. Tipp: Ein kleiner Morgenkaffee ist für viele ein Stück Lebensqualität; wenn Du darauf nicht verzichten willst, trinke ihn mit viel Milch (das Eiweiß mildert die Koffeinwirkung etwas) und verzichte im restlichen Tagesverlauf auf weitere Koffeinquellen. Energy-Drinks solltest Du aber wirklich meiden – die Kombination aus Hochdosis-Koffein und Zucker pusht den Stoffwechsel unnötig und treibt Puls sowie Blutdruck hoch.
- Alkohol: Alkoholische Getränke belasten den Körper und können Herzklopfen sowie Hitzewallungen begünstigen. Besonders in Kombination mit Koffein (etwa Mixgetränke wie Wodka-Energy) ist Alkohol Gift für den ohnehin überforderten Organismus. Übermäßiger Alkoholkonsum schwächt zudem das Immunsystem. Gegen ein gelegentliches Glas Wein oder Bier in Maßen spricht nichts – aber in Phasen starker Symptome verzichte besser ganz auf Alkohol. Dein Körper hat schon genug Stress, da muss er nicht auch noch Ethanol abbauen.
- Rauchen: (Zwar kein Lebensmittel, aber wichtig.) Rauchen verschlechtert den Verlauf von Morbus Basedow – insbesondere die endokrine Orbitopathie (Augenbeteiligung) verläuft bei Rauchern deutlich schwerer. Raucher haben ein höheres Risiko für ausgeprägte Augenprobleme. Wenn Du rauchst, versuche gerade in der akuten Phase aufzuhören – Deiner Schilddrüse und Deinen Augen zuliebe.
- Sehr zuckerreiche Kost: Ein überaktiver Stoffwechsel geht oft mit Heißhunger auf Süßes einher – paradox, da man ja ohnehin abnimmt. Trotzdem sollten Riegel, Kuchen, Limonaden & Co. nur in Maßen genossen werden. Große Zuckermengen lassen den Blutzucker Achterbahn fahren und verstärken das innere Unruhegefühl. Besser sind komplexe Kohlenhydrate (Vollkorn, Obst), die den Bedarf decken, ohne extreme Blutzuckerspitzen zu verursachen. Außerdem kann eine dauerhaft hohe Zuckerzufuhr entzündliche Prozesse fördern, was bei einer autoimmun bedingten Überfunktion (Basedow) kontraproduktiv wäre.
- Schwer verdauliche Speisen: Da der Darm ohnehin „auf Turbo“ gestellt ist, können sehr fette und üppige Speisen zu Durchfall und Völlegefühl führen. Achte auf eine leicht bekömmliche Zubereitung: Lieber Dünsten, Dämpfen oder Kochen statt stark Frittiertem und Fettem. Viele kleine Mahlzeiten werden oft besser vertragen als wenige große.
- Soja und Gluten (bei autoimmuner Hyperthyreose): Hier scheiden sich die Geister etwas. Soja enthält zwar kein Jod, aber es gibt Hinweise, dass große Mengen Soja (aufgrund der Phytoöstrogene) die Schilddrüse beeinflussen können – in Tierversuchen wurde z.B. die Wirkung von Schilddrüsenmedikamenten durch exzessive Sojazufuhr abgeschwächt(33,34). Für Hyperthyreose-Patienten ohne Medikamente ist Soja zwar nicht verboten, aber genieße es in Maßen und nicht als Hauptnahrungsmittel. Ein bis zwei Portionen Tofu oder Sojadrink am Tag sind unproblematisch; eine hochdosierte Soja-Proteinergänzung würde ich vermeiden. Gluten steht im Fokus, weil autoimmune Schilddrüsenerkrankungen wie Morbus Basedow und Zöliakie (Glutenunverträglichkeit) gehäuft gemeinsam auftreten. Auch ohne Zöliakie vermuten manche Experten, dass Gluten die Darmbarriere beeinflussen und Autoimmunprozesse befeuern könnte. Es gibt derzeit aber keine klaren Belege, dass eine glutenfreie Diät Morbus Basedow „heilt“. Einige Patienten berichten zwar von Besserung, wenn sie auf Weizen & Co. verzichten – das ist jedoch individuell. Mein Rat: Wenn Du keine medizinische Notwendigkeit hast (Zöliakie-Test negativ) und Gluten gut verträgst, musst Du nicht strikt glutenfrei essen. Achte eher auf Qualität (Vollkorn statt Weißmehl) und beobachte Deinen Körper. Falls Dir glutenhaltige Kost offensichtliches Unwohlsein bereitet, sprich mit Deinem Arzt über einen Versuch einer Glutenkarenz. Aber erwarte keine Wunder – in den meisten Fällen bringt es keinen großen Vorteil, und der Verzicht wäre erheblich. Priorität haben wirklich die oben genannten Punkte (Jod, Mikronährstoffe, Koffein etc.).
FAZIT Ernährung: Eine an die Hyperthyreose angepasste Ernährung bedeutet: ausreichend, aber bewusst essen. Gib Deinem Körper genug Kalorien und Eiweiß, um Abbau vorzubeugen; versorge Dich mit allen Vitaminen und Mineralstoffen, um den Mehrbedarf zu decken; führe Jod nur moderat zu (keine Exzesse); und meide alles, was den „Turbo“ zusätzlich antreibt (z.B. übermäßig Koffein, Zucker, Alkohol). So schaffst Du ein Umfeld, in dem sich Dein Körper besser stabilisieren kann. Viele Betroffene berichten, dass sie sich mit diesen Anpassungen deutlich besser fühlen: Das Herzrasen wird erträglicher, das Gewicht stabilisiert sich, die Muskelschwäche nimmt ab – man gewinnt insgesamt wieder ein Gefühl von Kontrolle zurück.
Interessant ist auch, dass die generelle Ernährungsweise möglicherweise einen Einfluss auf das Hyperthyreose-Risiko hat. In einer großen prospektiven Studie war das Risiko für Hyperthyreose bei Veganern rund 52% niedriger als bei Allesessern(35). Das beweist zwar keine Kausalität, deutet aber darauf hin, dass eine überwiegend pflanzliche, vollwertige Kost der Schilddrüsengesundheit zuträglich sein könnte – vielleicht wegen des moderateren Jodkonsums und der vielen Antioxidantien. Jedenfalls schadet es nicht, vermehrt auf pflanzliche Vielfalt zu setzen.
Lebensstil & weitere Tipps bei Schilddrüsenüberfunktion
Stressmanagement
Psychischer Stress kann Symptome einer Hyperthyreose spürbar verschlechtern – es gibt sogar Hinweise, dass großer Stress ein Auslöser für Morbus Basedow sein kann. Achte deshalb besonders auf seelische Ausgeglichenheit. Entspannungstechniken wie Progressive Muskelentspannung, Yoga, Atemübungen oder Meditation können das übererregte Nervensystem beruhigen und Herz sowie Psyche entlasten. Plane bewusst tägliche Entspannungspausen ein – schon 10 Minuten tiefe Bauchatmung oder eine geführte Meditation am Abend helfen, den Adrenalinspiegel zu senken. Auch Spaziergänge an der frischen Luft wirken ausgleichend. Versuche, größere psychosoziale Stressoren (soweit möglich) zu reduzieren. Dein Körper befindet sich durch die überschüssigen Hormone ohnehin im „Stressmodus“ – jede zusätzliche Entlastung ist Gold wert.
Schlafhygiene
Viele Menschen mit Schilddrüsenüberfunktion kämpfen mit Schlafstörungen. Dabei ist guter Schlaf enorm wichtig für die Regeneration. Schaffe deshalb eine optimale Schlafumgebung: kühl, dunkel und ruhig. Vermeide spätabends Bildschirmarbeit oder aufregende Tätigkeiten – gib Deinem Körper Zeit, herunterzufahren. Ein entspannendes Abendritual kann helfen (z.B. ein warmes Bad mit Lavendelöl, eine Tasse Kräutertee, etwas lesen). Pflanzliche Helfer wie Baldrian oder Passionsblume (siehe oben) kannst Du gezielt vor dem Schlafengehen einsetzen. Eventuell verschreibt Dir Dein Arzt vorübergehend ein mildes Schlafmittel oder einen Betablocker für die Nacht – scheue Dich nicht, solche Hilfen anzunehmen, damit Du zu Deinem dringend benötigten Schlaf kommst. Sobald sich Deine Schilddrüsenwerte normalisieren, wird sich erfahrungsgemäß auch der Schlaf wieder deutlich verbessern.
Moderate Bewegung
Du fühlst Dich vielleicht erschöpft und zittrig, aber völlige Schonung ist auf Dauer auch nicht ideal. Leichte körperliche Aktivität – angepasst an Dein aktuelles Befinden – kann hilfreich sein, um dem Muskelabbau entgegenzuwirken, die Stimmung zu heben und den Appetit anzuregen. Wichtig ist, es nicht zu übertreiben: Solange die Überfunktion nicht im Griff ist, vermeide hochintensiven Sport (kein Marathonlauf, kein HIIT-Training), denn das könnte Herz und Kreislauf überlasten. Besser sind moderate Ausdauereinheiten wie Spaziergänge, Radfahren auf ebenen Strecken, lockeres Schwimmen oder sanftes Yoga. Höre auf Deinen Körper: Wenn Du dabei Herzrasen oder Schwindel spürst, lege eine Pause ein. An guten Tagen kannst Du auch leichte Kräftigungsübungen (mit dem eigenen Körpergewicht oder kleinen Hanteln) versuchen, um die Muskeln zu erhalten. Es geht nicht um Leistung, sondern um Wohlbefinden und Funktionserhalt. Schon tägliche 20–30 Minuten Bewegung an der frischen Luft wirken positiv – sie verbessern auch den Schlaf und reduzieren Stress. Sobald Deine Werte wieder normal sind, kannst Du das Pensum nach und nach steigern.
Flüssigkeitshaushalt
Durch vermehrtes Schwitzen und einen schnellen Stoffwechsel verlierst Du mehr Flüssigkeit und Elektrolyte als gewöhnlich. Achte also darauf, genug zu trinken – ca. 2,5 bis 3 Liter pro Tag sollten es sein (vorzugsweise Wasser, ungesüßter Kräutertee oder verdünnte Saftschorlen). Bei sehr starkem Schwitzen können auch isotonische Getränke oder eine Brühe hilfreich sein, um Salzverluste auszugleichen. Ein guter Indikator dafür, dass Du genug trinkst, ist nahezu farbloser Urin und wenn erst gar kein Durstgefühl aufkommt. Gerade wenn man nervös und abgelenkt ist, vergisst man leicht das Trinken – stelle Dir also am besten immer ein Glas Wasser griffbereit hin.
Regelmäßige ärztliche Kontrollen
Das mag selbstverständlich klingen, soll aber betont werden: Lass Deine Schilddrüsenwerte engmaschig überwachen, vor allem in der Einstellungsphase der Therapie. Nur so kann der Arzt die Medikamentendosis optimal anpassen. Eine Hyperthyreose kann sich dynamisch verändern – es gibt Phasen, in denen die Überfunktion plötzlich wieder aufflackert (z.B. bei Basedow ein Rückfall), oder Zeiten, in denen sie zurückgeht. Wenn sich Deine Symptome verändern (etwa erneut zunehmendes Herzrasen oder Gewichtsverlust trotz Behandlung), sprich sofort Deinen Arzt darauf an. Auch ein Übergang in eine Unterfunktion (z.B. wenn die Medikation zu stark war oder nach Radiojodtherapie) muss schnell erkannt werden. Mit Laborkontrollen alle 4–6 Wochen am Anfang bist Du auf der sicheren Seite.
Augen und Spezialisten
Speziell bei Morbus Basedow gilt: Wenn Du Augenbeschwerden bemerkst (Druckgefühl, Doppelbilder, hervortretende Augen), ziehe frühzeitig einen Augenarzt hinzu. Die endokrine Orbitopathie sollte von einem spezialisierten Augenarzt betreut werden. Es gibt therapeutische Maßnahmen (Augentropfen, Prismenbrille und in schweren Fällen hochdosiertes Kortison oder Bestrahlung), um die Augen zu schützen. Du selbst kannst bei leichten Augenproblemen durch kühle Kompressen oder befeuchtende Augentropfen Linderung verschaffen. Nachts hilft es, den Kopf leicht erhöht zu lagern, um Schwellungen der Augenlider zu reduzieren. Und – wie oben schon erwähnt – höre mit dem Rauchen auf, da es die Augenbeteiligung massiv verschlimmern kann.
Geduld und Psyche
Eine Schilddrüsenüberfunktion ist auch psychisch eine Herausforderung – die ständige innere Unruhe, die körperlichen Veränderungen und möglicherweise die Belastung, mit einer Autoimmunerkrankung zu leben. Unterschätze diese Faktoren nicht. Es ist völlig normal, sich zeitweise überfordert, ängstlich oder niedergeschlagen zu fühlen. Wichtig ist, darüber zu sprechen – mit Freunden, Familie oder auch in einer Selbsthilfegruppe. Allein zu wissen, dass andere Ähnliches durchmachen, kann sehr entlastend sein. Scheue Dich auch nicht, professionelle Unterstützung durch einen Psychologen oder Psychotherapeuten in Anspruch zu nehmen, um Ängste und Stimmungsschwankungen zu bewältigen. Denke immer daran: Eine Hyperthyreose ist behandelbar, und die allermeisten Menschen erlangen wieder ein normales Gleichgewicht. Die Phase der Überfunktion ist meistens zeitlich begrenzt (Monate bis wenige Jahre). Halte Dir vor Augen, dass es besser werden wird. Deine Aufgabe ist es, in dieser Zeit gut für Dich zu sorgen – medizinisch und lebensstilmäßig – damit Du gestärkt daraus hervorgehst.
Abschließend: Mit der richtigen Kombination aus ärztlicher Therapie, angepasster Ernährung, maßvoller Bewegung, konsequenter Entspannung und enger medizinischer Begleitung kannst Du die Schilddrüsenüberfunktion erfolgreich in den Griff bekommen. Jeder kleine Baustein hilft Dir, Dich besser zu fühlen und Deinen Körper auf dem Weg der Besserung zu unterstützen. Die Schilddrüse ist ein erstaunlich regenerationsfähiges Organ – gib ihr die nötige Zeit und Unterstützung. Die Chancen stehen sehr gut, dass Du bald wieder im Gleichgewicht bist.
Wichtiger Hinweis: Die genannten Maßnahmen dienen der Unterstützung und Begleitung der schulmedizinischen Therapie. Sie ersetzen keinesfalls die vom Arzt empfohlene Behandlung. Bei anhaltenden oder schweren Symptomen suche bitte stets ärztlichen Rat.
- Zheng, H. et al. (2018). Effects of Selenium Supplementation on Graves’ Disease: A Systematic Review and Meta-Analysis. International Journal of Endocrinology, 2018:3763565. DOI: 10.1155/2018/3763565 (Meta-Analyse: Selen-Einnahme senkt fT4/fT3 und erhöht TSH bei Morbus Basedow kurzfristig)
- Benvenga, S. et al. (2001). Usefulness of L-carnitine, a naturally occurring peripheral antagonist of thyroid hormone action, in iatrogenic hyperthyroidism: A randomized, double-blind, placebo-controlled clinical trial. Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism, 86(8), 3579-3594. DOI: 10.1210/jcem.86.8.7747 (Studie: L-Carnitin reduzierte Symptome der Hyperthyreose und verbesserte Muskelkraft sowie Knochendichte)
- Beer, A.-M. et al. (2008). Lycopus europaeus (Gypsywort): effects on the thyroidal parameters and symptoms associated with thyroid function. Phytomedicine, 15(1-2), 16-22. DOI: 10.1016/j.phymed.2007.11.001 (Offene Pilotstudie: Wolfstrapp-Extrakt verringerte Herzklopfen und stabilisierte Schilddrüsenwerte bei leichter Hyperthyreose)
- Kawara, R. S. M. et al. (2024). Melissa officinalis extract palliates redox imbalance and inflammation associated with hyperthyroidism-induced liver damage by regulating Nrf2/Keap-1 gene expression in γ-irradiated rats. BMC Complementary Medicine and Therapies, 24:71. DOI: 10.1186/s12906-024-04370-z (Tierstudie: Melissen-Extrakt senkte T3/T4-Spiegel und verbesserte Leberwerte bei hyperthyreoten Ratten)
- Bashar, M. A. & Begam, N. (2020). Role of dietary factors in thyroid disorders – Current evidences and way forwards. Thyroid Research and Practice, 17(3), 104-109. DOI: 10.4103/trp.trp_7_20 (Review: Ernährungsfaktoren bei Schilddrüsenerkrankungen – Evidenz am stärksten für angemessene Jodzufuhr und Selen; Datenlage zu anderen Faktoren (Soja, Gluten etc.) begrenzt)
- Farebrother, J. et al. (2019). Excess iodine intake: sources, assessment, and effects on thyroid function. Annals of the New York Academy of Sciences, 1446(1), 44-65. DOI: 10.1111/nyas.14041 (Übersicht: Sehr hohe Jodaufnahmen können bei disponierten Personen eine Hyperthyreose auslösen – Jod-Basedow-Effekt insbesondere nach vorangegangenem Jodmangelstruma)
- Tonstad, S. et al. (2015). Prevalence of hyperthyroidism according to type of vegetarian diet. Public Health Nutrition, 18(8), 1482-1487. DOI: 10.1017/S1368980014002183 (Adventist Health Study 2: Veganer hatten ein 52% niedrigeres Hyperthyreose-Risiko als Omnivore – Hinweis auf mögliche protektive Effekte pflanzlicher Ernährung)
- Pang, B. et al. (2024). Association between serum vitamin D level and Graves’ disease: a systematic review and meta-analysis. Nutrition Journal, 23:60. DOI: 10.1186/s12937-024-00960-2 (Meta-Analyse: Patienten mit Morbus Basedow hatten signifikant niedrigere Vitamin-D-Spiegel als Gesunde; Vitamin-D-Mangel könnte das Basedow-Risiko erhöhen)
- Blum, M. R. et al. (2015). Subclinical thyroid dysfunction and fracture risk: a meta-analysis. JAMA, 313(20), 2055-2065. DOI: 10.1001/jama.2015.5161 (Meta-Analyse von 13 Kohorten: Bereits subklinische Hyperthyreose erhöht das Risiko für Hüft- und Gesamtfrakturen um ~30% – Bedeutung der Osteoporose-Prophylaxe)
- Burch, H. B. & Cooper, D. S. (2015). Management of Graves Disease: A Review. JAMA, 314(23), 2544-2554. DOI: 10.1001/jama.2015.16535 (Aktuelle Übersichtsarbeit zur Behandlung des Morbus Basedow: erläutert medikamentöse, radiojod- und chirurgische Optionen sowie Komplikationen; betont auch Patientenaufklärung und engmaschiges Monitoring)
- Vonhoff, C. et al. (2006). Extract of Lycopus europaeus L. reduces cardiac signs of hyperthyroidism in rats. Life Sciences, 78(10), 1063-1070. DOI: 10.1016/j.lfs.2005.06.014 (Experimentelle Studie: Lycopus-Extrakt reduzierte bei thyroxinbehandelten Ratten Herzfrequenz, Blutdruck und Herzhypertrophie – Wirkung ähnlich einem Betablocker)