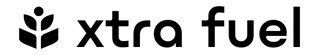Synergie von Vitamin D3 und K2 – Grundlagen
Vitamin D3 (Cholecalciferol) und Vitamin K2 (Menaquinon) sind fettlösliche Vitamine, die im menschlichen Stoffwechsel unterschiedliche, aber miteinander verknüpfte Rollen spielen. Vitamin D3 wird entweder über die Haut unter Sonneneinstrahlung gebildet oder über Lebensmittel wie fettreiche Fische und Pilze aufgenommen und in der Leber zu 25‑Hydroxyvitamin D umgewandelt. In den Nieren entsteht daraus die hormonell aktive Form 1,25‑Dihydroxyvitamin D, die die Kalzium‑ und Phosphataufnahme im Darm reguliert und damit das Knochenwachstum und den Mineralstoffhaushalt beeinflusst. Vitamin K2 ist ein Oberbegriff für verschiedene Menachinone (MK‑4 bis MK‑13) und wird in Lebensmitteln wie fermentiertem Soja (Natto), fermentierten Milchprodukten und Fleisch von Weidetieren gefunden. Vitamin K2 aktiviert γ‑Carboxyglutamat‑(Gla)-haltige Proteine, darunter Osteocalcin und die Matrix‑Gla‑Protein (MGP), indem es diese Proteine carboxyliert. So können sie Kalzium binden und in Knochengewebe einlagern. Ohne ausreichend Vitamin K2 verbleiben diese Proteine untercarboxyliert und können ihre Aufgabe nicht erfüllen.
Neuere Forschungsarbeiten zeigen, dass Vitamin D3 und K2 synergistisch wirken. Vitamin D regt die Produktion von Vitamin‑K‑abhängigen Proteinen an, die für die Kalziumbindung in Knochen und Blutgefäßen wichtig sind, während Vitamin K deren Aktivierung ermöglicht. Eine Übersichtsarbeit im International Journal of Endocrinology beschreibt, dass Vitamin D die Bildung von Osteocalcin und MGP stimuliert; diese Proteine müssen durch Vitamin K2 carboxyliert werden, um Kalzium ordnungsgemäß binden zu können[0]. Ohne diese Carboxylierung kann Kalzium sich in Gefäßen ablagern und das Risiko für Arteriosklerose erhöhen. Das Verständnis dieser Wechselwirkung bildet die Grundlage für die folgende ausführliche Betrachtung.
Warum eine ausgewogene Versorgung wichtig ist
In Mitteleuropa ist Vitamin‑D‑Mangel weit verbreitet. Eine aktuelle Querschnittsstudie an deutschen Spitzensportlern ergab, dass 55,5 % der Athleten einen unzureichenden 25‑Hydroxyvitamin‑D‑Spiegel (< 30 ng/ml) und 16 % sogar einen Mangel (< 20 ng/ml) aufweisen. In der deutschen Allgemeinbevölkerung haben laut derselben Arbeit 61,5 % der Erwachsenen einen 25(OH)D‑Spiegel unter 20 ng/ml. Vitamin‑D‑Mangel ist mit einem erhöhten Risiko für Osteoporose, Muskelschwäche und Infektionen verbunden. Vitamin K‑Mangel gilt als seltener; er kann jedoch durch unausgewogene Ernährung, chronische Lebererkrankungen oder Langzeittherapien mit Antibiotika auftreten. Untercarboxyliertes Osteocalcin im Serum dient als Marker für Vitamin‑K‑Mangel und ist mit erhöhter Knochenfragilität assoziiert.
Der Bedarf an Vitamin D hängt vom Alter, dem Körpergewicht, dem Hauttyp, der Sonnenexposition und individuellen Faktoren ab. Ein Workshopbericht empfiehlt für Personen ab 65 Jahren eine tägliche Zufuhr von 20 µg (800 IU), um 25(OH)D‑Spiegel von über 75 nmol/l zu erreichen[3]. Laut denselben Empfehlungen benötigen Erwachsene 10–20 µg (400–800 IU) pro Tag, um 25(OH)D‑Spiegel von 50–75 nmol/l aufrechtzuerhalten, wobei im Winter oft ein höherer Bedarf besteht[4]. Studien, die synergistische Effekte untersuchen, verwenden meist Dosierungen von 45–180 µg MK‑7 oder 45 mg Menatetrenon (MK‑4).
Risikogruppen für Vitamin‑D‑ und K‑Mangel
- Ältere Menschen und Personen mit dunkler Hautfarbe: Die Fähigkeit der Haut, Vitamin D zu bilden, nimmt mit dem Alter und bei dunkler Pigmentation ab. Gleichzeitig steigt das Risiko für Osteoporose und Herz‑Kreislauf‑Erkrankungen.
- Menschen, die wenig Sonnenlicht bekommen: Büroangestellte, Bewohner nördlicher Breitengrade oder Personen, die religiöse Kleidung tragen, können ihre Vitamin‑D‑Synthese nicht ausreichend aktivieren. In solchen Fällen kann eine Supplementierung helfen, den Bedarf zu decken.
- Veganer und Vegetarier: Vitamin D3 kommt vor allem in tierischen Lebensmitteln wie fettreichen Fischen und Eiern vor. Vegane Alternativen wie Pilze und angereicherte Pflanzenmilch enthalten häufig Vitamin D2. Vitamin K2 ist in fermentierten Lebensmitteln (Natto, gereifter Käse) enthalten; wer diese nicht regelmäßig verzehrt, könnte einen Mangel entwickeln.
- Menschen mit Malabsorption: Chronisch entzündliche Darmerkrankungen, Zöliakie, Leber- oder Gallenwegserkrankungen und die langfristige Einnahme bestimmter Medikamente (z. B. Antibiotika, Cholestyramin) können die Aufnahme fettlöslicher Vitamine beeinträchtigen.
- Schwangere und Stillende: Der Vitamin‑D‑Bedarf steigt während der Schwangerschaft und Stillzeit an, um die Entwicklung des Kindes zu unterstützen. Allerdings gelten individuelle Empfehlungen – zu hohe Dosierungen sollten vermieden werden.
Personen dieser Gruppen sollten ihre Serumwerte von Vitamin D und gegebenenfalls Vitamin K bestimmen lassen und mit ihrem Arzt besprechen, ob eine Supplementierung sinnvoll ist. Eine Überdosierung kann zu Hyperkalzämie führen; daher sollten Nahrungsergänzungsmittel verantwortungsvoll eingesetzt werden.
Vitamin D3 – Struktur, Stoffwechsel und Funktionen
Vitamin D3 ist ein Prohormon, das in der Haut aus 7‑Dehydrocholesterol unter dem Einfluss von UV‑B‑Licht entsteht. Über 80–90 % des Vitamin‑D‑Bedarfs wird durch endogene Synthese gedeckt, der Rest stammt aus der Nahrung. Im Blut wird Vitamin D an ein Bindungsprotein (VDBP) gebunden und in der Leber zu 25‑Hydroxyvitamin D (25(OH)D) hydroxyliert, das als Speicherform und Biomarker dient. In der Niere folgt die zweite Hydroxylierung zu 1,25‑Dihydroxyvitamin D (Calcitriol), das als Hormon fungiert. Calcitriol bindet an den Vitamin‑D‑Rezeptor (VDR), der in zahlreichen Geweben exprimiert ist, darunter Knochen, Skelettmuskeln und Immunzellen.
Knochengesundheit: Calcitriol steigert die Expression von Transportproteinen im Darm (Calbindin), wodurch Kalzium und Phosphat effizienter aufgenommen werden. Zudem reguliert Vitamin D den Knochenumbau, indem es sowohl Osteoblasten (bilden Knochenmatrix) als auch Osteoklasten (bauen Knochen ab) beeinflusst. Ein Mangel führt zu vermindertem Knochenmineralgehalt, Rachitis bei Kindern und Osteomalazie bei Erwachsenen. Eine Meta‑Analyse von acht randomisierten kontrollierten Studien mit insgesamt 971 Teilnehmern zeigt, dass die Kombination von Vitamin D und K die Gesamt‑Knochendichte signifikant erhöht und den Anteil an untercarboxyliertem Osteocalcin verringert[6]. Diese Ergebnisse deuten darauf hin, dass Vitamin D3 allein zwar Kalzium in den Körper bringt, Vitamin K2 jedoch benötigt wird, um es korrekt zu verwerten.
Immunfunktion: Der VDR ist in verschiedenen Immunzellen vorhanden, darunter T‑Zellen, B‑Zellen, Dendritische Zellen und Makrophagen. Ein Review aus Frontiers in Immunology erklärt, dass die aktive Form von Vitamin D eine tolerogene Immunantwort fördert und sowohl angeborene als auch adaptive Immunreaktionen moduliert[7]. Vitamin‑D‑Mangel wird mit einem erhöhten Risiko für Autoimmunerkrankungen, Infektionen und chronische Entzündungen assoziiert. In einer großen randomisierten Studie (VITAL‑Trial) wurde ein tägliches Vitamin‑D‑Supplement (2 000 IU) eingesetzt; nach einer medianen Nachbeobachtungszeit von fünf Jahren verringerte Vitamin D die Inzidenz von Autoimmunerkrankungen (Hazard Ratio 0,78)[8]. Der Effekt war jedoch nach Absetzen des Präparats zwei Jahre später nicht mehr nachweisbar. Dies unterstreicht, dass Vitamin D3 das Immunsystem modulieren kann, aber nicht als Heilmittel gilt.
Muskelfunktion und Sport: Vitamin D wird auch mit der Muskelkraft und Leistungsfähigkeit in Verbindung gebracht. In einer retrospektiven Studie mit älteren Menschen führte die tägliche Einnahme von Vitamin D3 über mehrere Monate zu einer signifikanten Erhöhung des 25(OH)D‑Spiegels sowie einer Verbesserung der Muskelkraft in den unteren Extremitäten und der Handkraft[9]. Athleten mit niedrigen Vitamin‑D‑Spiegeln sind anfälliger für Stressfrakturen und Infekte, weshalb eine adäquate Versorgung – idealerweise durch Sonnenexposition und gegebenenfalls Nahrungsergänzung – für sportlich aktive Menschen wichtig ist.
Vitamin K2 – Formen, Funktion und Bedeutung
Vitamin K existiert in zwei Hauptformen: Vitamin K1 (Phyllochinon) und Vitamin K2 (Menaquinone). Vitamin K1 stammt vor allem aus grünen Blattgemüsen wie Spinat, Kohl und Brokkoli und trägt zur Blutgerinnung bei. Vitamin K2 umfasst eine Familie von Menachinonen (MK‑4 bis MK‑13) und ist in fermentierten Lebensmitteln (Natto, Sauerkraut, gereifter Käse) sowie in tierischen Produkten (Leber, Eigelb) enthalten. MK‑4 wird in bestimmten Geweben aus Vitamin K1 umgewandelt, während MK‑7 bis MK‑10 häufig bakterieller Herkunft sind.
Aktivierung von Gla‑Proteinen: Vitamin K2 ist ein notwendiger Cofaktor für die Carboxylierung von Gla‑Proteinen. Dazu gehören Osteocalcin, das Kalzium in die Knochenmatrix transportiert, und das Matrix‑Gla‑Protein (MGP), das Kalziumablagerungen in Gefäßwänden verhindert. Ohne Carboxylierung bleiben diese Proteine inaktiver Zustand, was zu einer verminderten Knochenstabilität und erhöhten Gefäßverkalkungen führen kann. Eine systematische Übersichtsarbeit von 2022 kam zu dem Ergebnis, dass Vitamin K2 die Knochenmineraldichte in postmenopausalen Frauen verbessert und die Frakturrate senkt; eine Kombination mit Vitamin D3 und/oder Kalzium führte zu deutlich besseren Ergebnissen als Vitamin K2 alleine[10].
Unterschiedliche Menachinon‑Formen: MK‑7 weist eine längere Halbwertszeit im Plasma auf (etwa 2–3 Tage) als MK‑4, wodurch eine tägliche Einnahme niedriger Dosen ausreichend sein kann. MK‑4 wird häufig in höheren Dosen (45 mg) angewendet, da seine Plasmahalbwertszeit nur wenige Stunden beträgt. Eine randomisierte, doppelblinde Studie mit postmenopausalen Frauen untersuchte die Einnahme von MK‑7 (375 µg/Tag) über drei Jahre in Kombination mit Vitamin D3 (38 µg/Tag) und Kalzium (800 mg/Tag). Dabei sank die Menge an untercarboxyliertem Osteocalcin im MK‑7‑Arm signifikant, die Knochendichte unterschied sich jedoch nicht von der Placebogruppe[11]. Dies zeigt, dass MK‑7 zwar die Carboxylierung von Osteocalcin verbessert, eine alleinige Gabe aber möglicherweise nicht ausreicht, um die Knochendichte zu steigern.
Kardiovaskuläre Effekte: Das Matrix‑Gla‑Protein (MGP) ist ein starker Inhibitor der Gefäßverkalkung. Eine narrative Übersichtsarbeit in Open Heart hebt hervor, dass Vitamin K2 die Aktivierung von MGP fördert und mit einer Verringerung der arteriellen Steifigkeit sowie einer verlangsamten vaskulären und valvulären Verkalkung assoziiert ist[12]. Ein Mangel an aktivem MGP erhöht die Ablagerung von Kalzium in Blutgefäßen und könnte das Risiko für Herz‑Kreislauf‑Erkrankungen erhöhen. Es ist jedoch anzumerken, dass die bisherige Evidenz größtenteils aus Beobachtungsstudien stammt; randomisierte kontrollierte Studien stehen noch aus. Solche Zusammenhänge sind daher bislang nicht von der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA) bestätigt. Weitere Studien sind erforderlich.
Synergie von Vitamin D3 und K2: Wissenschaftliche Evidenz
Die Synergie zwischen Vitamin D3 und K2 beruht darauf, dass beide Vitamine an unterschiedlichen, aber komplementären Stellen des Kalziumstoffwechsels eingreifen. Vitamin D fördert die Aufnahme von Kalzium und die Synthese von Osteocalcin und MGP, während Vitamin K2 deren Aktivierung ermöglicht. Ohne Vitamin K2 würde ein erhöhter Vitamin‑D‑Spiegel zu einer vermehrten Bildung inaktiver Proteine führen, die Kalzium nicht in den Knochen einbauen können. Zahlreiche Studien untersuchen daher die kombinierte Einnahme beider Vitamine:
- Meta‑Analyse zu Vitamin D und K: Eine systematische Auswertung im Journal Food & Function (2020) analysierte acht randomisierte kontrollierte Studien mit insgesamt 971 Teilnehmern. Die Autoren berichteten, dass die Kombination von Vitamin D und K die Gesamtknochendichte signifikant erhöhte und den Anteil untercarboxylierten Osteocalcins stark senkte, besonders wenn Vitamin K2 (MK‑7) eingesetzt wurde[13]. Dieses Ergebnis legt nahe, dass die synergistische Wirkung auf der Verbesserung der Proteinaktivierung und der Kalziumeinlagerung in den Knochen beruht.
- Prospektive Studie zur Wirbelsäulenfusion: Eine im Mai 2025 veröffentlichte klinische Studie untersuchte 71 osteoporotische Patienten nach minimalinvasiver Wirbelsäulenfusion. Die Testgruppe erhielt Vitamin K2 (45 mg/Tag), Vitamin D3 (250 IU/Tag) und Kalzium (1,2 g/Tag), die Kontrollgruppe nur Vitamin D3 und Kalzium. Nach sechs Monaten war die Fusionsrate in der Kombinationsgruppe signifikant höher (91,67 % vs. 74,29 %) und der Knochenbildungsmarker P1NP stieg deutlicher an[14]. Dies deutet darauf hin, dass Vitamin K2 die Knochenheilung nach Operationen fördern kann, wobei die Studie nicht randomisiert war und weitere Forschung nötig ist.
- Koreanische Studie bei postmenopausalen Frauen: In einem sechsmonatigen randomisierten kontrollierten Versuch mit postmenopausalen Frauen erhielten 38 Teilnehmerinnen täglich Vitamin K2 (Menatetrenon, 15 mg dreimal täglich), Vitamin D (400 IU) und Kalzium; die Kontrollgruppe bekam nur Vitamin D und Kalzium. Die L3‑Knochendichte stieg in der Vitamin‑K‑Gruppe signifikant an, während sie in der Kontrollgruppe leicht abnahm. Gleichzeitig sank der Serumspiegel untercarboxylierten Osteocalcins deutlich stärker in der Vitamin‑K‑Gruppe[15].
- Querschnittsstudie mit 8 216 Teilnehmern: Eine Übersichtsarbeit im Current Research in Nutrition and Food Science untersuchte zwölf Studien (fünf RCTs, sechs Beobachtungsstudien, ein quasi-experimentelles Design) mit insgesamt 8 216 Teilnehmern. Elf dieser Studien zeigten eine synergistische Wirkung von Vitamin D und K auf die Verbesserung der Knochenmineraldichte, die Verringerung von Frakturen und die Verbesserung von Herz‑Kreislauf‑Markern[16]. Die Autoren betonten, dass sich Vitamin D und K gegenseitig verstärken, was für die Prävention von Osteoporose und arteriosklerotischen Erkrankungen relevant ist.
- Randomisierte Placebo-kontrollierte MK‑7‑Studie: In einer dreijährigen Studie mit 142 postmenopausalen Frauen mit Osteopenie erhielten alle Teilnehmerinnen Vitamin D3 (38 µg/Tag) und Kalzium (800 mg/Tag). Zusätzlich bekam die Verumgruppe 375 µg MK‑7 täglich. Nach einem Jahr sank der Anteil untercarboxylierten Osteocalcins in der MK‑7‑Gruppe signifikant stärker (–65,2 % vs. –0,03 % in der Placebo-Gruppe), doch über drei Jahre zeigte sich kein Unterschied in der Knochenmineraldichte zwischen den Gruppen[17]. Dies unterstreicht, dass MK‑7 zwar die Aktivierung von Osteocalcin verbessert, aber nicht zwangsläufig allein ausreichend ist, um die Knochendichte zu erhöhen, wenn Vitamin D und Kalzium bereits ausreichend supplementiert werden.
Zusammenfassend zeigen diese Studien, dass die gemeinsame Einnahme von Vitamin D3 und K2 die Knochenmineralisation verbessert und den Anteil inaktiver Osteocalcin‑Moleküle reduziert. Gleichzeitig deuten erste Studien auf Vorteile für die kardiovaskuläre Gesundheit und die Knochenheilung hin. Allerdings variieren Dosierungen, Studiendauer und untersuchte Populationen stark; die Ergebnisse lassen sich daher nicht direkt auf alle Bevölkerungsgruppen übertragen. Für die Anwendung beim Menschen ist wichtig, die Dosierungsempfehlungen einzuhalten und keine Heilversprechen abzuleiten.
Kalzium, Vitamin D3 und K2: Ein Zusammenspiel für starke Knochen
Kalzium ist der am häufigsten vorkommende Mineralstoff im menschlichen Körper und bildet zusammen mit Phosphat die Struktur der Knochen. Eine adäquate Kalziumaufnahme über die Ernährung – beispielsweise durch Milchprodukte, Nüsse, Samen (Sesam, Mandeln), grünes Gemüse und Mineralwasser – ist Voraussetzung für eine stabile Knochenmatrix. Ohne ausreichend Vitamin D kann jedoch nur ein kleiner Teil des aufgenommenen Kalziums in den Blutkreislauf gelangen. Vitamin D3 erhöht die Bildung von Calbindin im Darm und steigert so die Kalziumabsorption. Die zusätzliche Gabe von Vitamin K2 stellt sicher, dass das aufgenommene Kalzium in die Knochen eingebaut und nicht in die Gefäßwände transportiert wird.
Eine Meta‑Analyse im Journal of Orthopaedic Surgery and Research untersuchte den kombinierten Effekt von Vitamin K und Kalzium auf die Knochengesundheit. Die Autoren analysierten sieben randomisierte kontrollierte Studien und stellten fest, dass Vitamin K zusammen mit Kalzium die Lendenwirbel‑Knochendichte stärker erhöhte und den Anteil untercarboxylierten Osteocalcins stärker senkte als Kalzium allein[18]. Interessanterweise war dieser Effekt vor allem bei Verwendung von Vitamin K2 ausgeprägt. In einer weiteren Meta‑Analyse wird hervorgehoben, dass sich die Kombination von Vitamin D, K und Kalzium besonders positiv auf die Knochenstärke auswirkt und Osteoporose vorbeugen kann[19]. Diese synergistischen Effekte lassen sich physiologisch erklären: Vitamin D sorgt für die Bereitstellung von Kalzium, Vitamin K aktiviert Osteocalcin, und Kalzium dient als Baustoff.
Dennoch ist darauf hinzuweisen, dass Supplemente allein keine ausgewogene Ernährung ersetzen. Eine kalziumreiche Kost, ausreichende Sonnenexposition, körperliche Aktivität (insbesondere Krafttraining und moderates Ausdauertraining) und ein gesunder Lebensstil sind Grundpfeiler der Knochengesundheit. Menschen, die ausreichend Kalzium über die Nahrung aufnehmen und sich regelmäßig im Freien bewegen, können ihre Vitamin‑D‑Synthese steigern und benötigen oft weniger Ergänzungsmittel. Bei diagnostiziertem Mangel oder bei Risikogruppen kann eine gezielte Einnahme von Vitamin D3 und K2 jedoch sinnvoll sein.
Auswirkungen auf das Herz‑Kreislauf‑System
Neben der Rolle für die Knochen spielt das Zusammenspiel von Vitamin D3 und K2 auch für die Gefäßgesundheit eine potenziell wichtige Rolle. Arterielle Verkalkungen werden unter anderem durch Matrix‑Gla‑Protein (MGP) reguliert. Dieses Protein bindet Kalzium in den Gefäßwänden und verhindert so die Kristallisation und Ablagerung in den Arterien. Die Aktivierung von MGP ist Vitamin‑K‑abhängig. Ohne genügend Vitamin K bleibt MGP uncarboxyliert und damit inaktiv – Kalzium kann sich leichter in den Gefäßen ablagern. Ein Review im Journal Open Heart betont, dass Vitamin K2 die Aktivierung von MGP fördert und so die arterielle Steifigkeit reduziert und eine langsamere Verkalkung von Gefäßen und Herzklappen bewirken könnte[20]. Die Autoren verweisen auf Studien, in denen eine erhöhte Aufnahme von Vitamin K2 mit geringerer kardiovaskulärer Mortalität korreliert. Es bleibt jedoch zu beachten, dass ein kausaler Nachweis durch randomisierte klinische Studien noch fehlt. Diese Zusammenhänge sind daher bislang nicht von der EFSA bestätigt, und es sind weitere Studien erforderlich, um konkrete Empfehlungen abzuleiten.
Vitamin D beeinflusst ebenfalls das Herz‑Kreislauf‑System, unter anderem durch Regulation des Renin‑Angiotensin‑Systems, des Blutdrucks und entzündlicher Prozesse. Vitamin‑D‑Mangel wurde mit Bluthochdruck, Herzinsuffizienz und Myokardinfarkt in Verbindung gebracht; dennoch konnte in klinischen Studien kein eindeutiger Nutzen einer Hochdosis‑Supplementierung festgestellt werden. Die meisten positiven Beobachtungen stammen aus epidemiologischen Studien, während randomisierte Studien wie der VITAL‑Trial keine signifikante Reduktion kardiovaskulärer Ereignisse durch Vitamin‑D‑Supplemente zeigten. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass eine ausreichende Versorgung mit Vitamin D und K zur Erhaltung normaler kardiovaskulärer Funktionen beitragen kann, ein therapeutischer Effekt jedoch bisher nicht belegt ist.
Einfluss auf das Immunsystem und Entzündung
Vitamin D3 moduliert das angeborene und adaptive Immunsystem. Calcitriol bindet an VDRs auf dendritischen Zellen und verhindert deren vollständige Reifung; dies fördert die Differenzierung regulatorischer T‑Zellen und hemmt entzündliche T‑Helfer‑Zellen. Vitamin D erhöht zudem die Expression antimikrobieller Peptide (z. B. Cathelicidin), die Bakterien und Viren bekämpfen. In dem genannten Frontiers in Immunology‑Review wird hervorgehoben, dass ein ausreichender Vitamin‑D‑Spiegel zu einer tolerogeneren Immunantwort führt und damit übermäßige Entzündungsreaktionen reduziert[21]. Der Zusammenhang zwischen Vitamin‑D‑Status und Infektionsanfälligkeit wurde während der COVID‑19‑Pandemie intensiv diskutiert, doch die Evidenz ist gemischt. Eine ausgewogene Versorgung wird empfohlen, um die normale Funktion des Immunsystems zu unterstützen.
Vitamin K2 hat ebenfalls immunmodulatorische Eigenschaften, die aber bislang weniger gut erforscht sind. Einige Studien deuten darauf hin, dass Vitamin K entzündungshemmend wirkt, indem es NF‑κB‑Signale hemmt und oxidative Stressreaktionen reduziert. Darüber hinaus ist Vitamin K für die Synthese des Proteins S erforderlich, das in der Gerinnungskaskade und dem Komplement‑System eine Rolle spielt. Ein möglicher synergistischer Effekt von Vitamin D3 und K2 könnte in der Kontrolle von Entzündungsprozessen liegen, doch hierzu fehlen derzeit solide klinische Daten. Diese Zusammenhänge sind noch nicht von der EFSA bestätigt; weitere Studien sind erforderlich.
Dosierung und sichere Anwendung von Vitamin D3 & K2
Die richtige Dosierung ist entscheidend, um Nutzen zu erzielen und Risiken zu vermeiden. Die meisten Studien, die synergistische Effekte beobachten, nutzen moderate Vitamin‑D‑Dosen zwischen 400 und 2 000 IU pro Tag, teilweise ergänzt durch eine Anfangsdosis (Loading Dose), um einen raschen Anstieg der 25(OH)D‑Spiegel zu erreichen. Der erwähnte Workshopbericht fasst zusammen, dass 1 µg (40 IU) Vitamin D pro Tag die Serumkonzentration von 25(OH)D um etwa 1 nmol/l erhöht[22]. Um einen 25(OH)D‑Spiegel über 75 nmol/l sicherzustellen, sind laut diesem Bericht oft 20 µg (800 IU) pro Tag notwendig, wobei individuelle Faktoren wie Körpergewicht, Ausgangswert und genetische Variationen zu berücksichtigen sind. Oberhalb von 100 µg (4 000 IU) pro Tag sollten Erwachsene Vitamin D nur unter ärztlicher Aufsicht einnehmen, da sonst ein Hyperkalzämierisiko besteht.
Für Vitamin K2 gibt es keine allgemeingültigen Referenzwerte. In klinischen Studien werden Dosierungen zwischen 45 µg (MK‑7) und 45 mg (MK‑4) eingesetzt. Die japanische Standarddosierung von Menatetrenon (MK‑4) zur Osteoporoseprophylaxe beträgt 45 mg pro Tag. Produkte mit MK‑7 enthalten in der Regel 50–200 µg pro Kapsel. Aufgrund der längeren Halbwertszeit von MK‑7 reicht eine tägliche Einnahme aus. Bei Personen, die Antikoagulanzien aus der Gruppe der Vitamin‑K‑Antagonisten (z. B. Warfarin) einnehmen, muss eine Supplementierung mit Vitamin K2 unbedingt mit dem behandelnden Arzt abgestimmt werden, da es die Wirksamkeit der Medikamente beeinflussen kann.
Zur sicheren Anwendung sollten folgende Punkte beachtet werden:
- Die Dosierung sollte individuell und unter Berücksichtigung von Serumwerten, Lebensstil und Ernährung gewählt werden.
- Vitamin D ist ein fettlösliches Vitamin; daher sollte es mit einer Mahlzeit eingenommen werden, die Fett enthält, um die Aufnahme zu verbessern.
- Vitamin K2 sollte für eine optimale Wirkung ebenfalls täglich eingenommen werden. Bei MK‑4 sind höhere Dosen notwendig, da es schneller abgebaut wird.
- Schwangere, Stillende, Kinder und Menschen mit chronischen Erkrankungen sollten vor der Einnahme von Nahrungsergänzungsmitteln einen Arzt konsultieren.
- Ein Zuviel an Kalzium, Vitamin D oder K kann Nebenwirkungen haben. Symptome einer Hyperkalzämie sind Übelkeit, Erbrechen, häufiges Wasserlassen und Herzrhythmusstörungen.
Natürliche Quellen für Vitamin D3 & K2
Eine ausgewogene Ernährung bleibt die Basis für die Versorgung mit Mikronährstoffen. Für Vitamin D3 sind folgende Quellen geeignet:
- Sonnenlicht: 15–30 Minuten unbedeckte Haut (Gesicht, Arme, Beine) zwischen 11 und 15 Uhr reichen im Sommer aus, um den Vitamin‑D‑Bedarf zu decken. Im Winter ist die UV‑B‑Strahlung in Deutschland geringer, weshalb Supplemente sinnvoll sein können.
- Fettreiche Fische: Lachs, Makrele, Hering und Sardinen liefern pro 100 g bis zu 20 µg Vitamin D3. Auch Lebertran ist reich an Vitamin D.
- Eier und Milchprodukte: Eigelb enthält moderate Mengen Vitamin D; einige Milchprodukte sind mit Vitamin D angereichert.
- Pilze: Bestimmte Pilzarten (z. B. Champignons), die unter UV‑Licht gezüchtet wurden, enthalten relevante Mengen Vitamin D2, das im Körper weniger effizient als D3 wirkt, aber zur Gesamtsynthese beiträgt.
- Angereicherte Lebensmittel: Pflanzliche Milch, Margarine und Frühstückszerealien sind häufig mit Vitamin D angereichert. Vegane Produkte sollten auf D3 aus Algen (vegan) achten.
Für Vitamin K2 werden folgende Nahrungsmittel empfohlen:
- Natto: Fermentierte Sojabohnen sind eine der reichsten Quellen für MK‑7. Eine Portion (50 g) kann bis zu 500 µg Vitamin K2 enthalten.
- Fermentierte Milchprodukte: Gereifter Käse (Brie, Gouda, Edamer), Kefir und Joghurt enthalten MK‑8 und MK‑9. Je länger der Reifeprozess, desto höher der Vitamin‑K2‑Gehalt.
- Fleisch und Organfleisch: Insbesondere Leber, Herz und andere Innereien von Weidetieren enthalten MK‑4.
- Eier von Freilandhühnern: Eier aus Freilandhaltung enthalten höhere Mengen an Vitamin K2 als Eier aus Käfighaltung, da die Hühner mehr grünes Futter aufnehmen.
- Fermentiertes Gemüse: Sauerkraut und Kimchi liefern moderate Mengen an Vitamin K2. Die Gehalte sind jedoch variabel und niedriger als in Natto.
Wer diese Lebensmittel selten isst, kann auf Nahrungsergänzungsmittel zurückgreifen, sollte aber dennoch auf eine abwechslungsreiche Ernährung achten.
Supplementierung: Vor‑ und Nachteile von Kapseln und Tabletten
Wer den Bedarf an Vitamin D3 und K2 nicht vollständig über Ernährung und Sonne decken kann, kann Nahrungsergänzungsmittel nutzen. Produkte gibt es in Form von Tropfen, Kapseln oder Tabletten. Sie unterscheiden sich in ihrer Dosierung, dem verwendeten Menachinon‑Typ und der Trägersubstanz. Bei der Wahl eines Produkts sollte auf Qualität, Reinheit und die richtige Balance der Vitamine geachtet werden. Für Veganer gibt es Präparate mit Vitamin D3 aus Flechten oder Algen und Vitamin K2 aus fermentierten Pflanzen.
Die Kombination aus Vitamin D3 und K2 in einem Präparat ist praktisch, da so das Verhältnis der Vitamine abgestimmt ist. Ein Beispiel sind optimale Vitamin D3 + K2 Tabletten, das pro Tagesportion eine moderate Menge Vitamin D3 und MK‑7 liefert. Solche Kombinationspräparate sind besonders für Personen geeignet, die sich nicht ausgewogen ernähren können oder unter erhöhtem Bedarf leiden. Dennoch sollten sie als Ergänzung zu einer gesunden Lebensweise und nicht als Ersatz verstanden werden.
Hier findest Du unser Produkt: XTRA FUEL Vitamin D3 + K2 Tabletten
Erfahrungsberichte und Anwendungstipps
Zahlreiche Menschen berichten von positiven Erfahrungen mit der Kombination aus Vitamin D3 und K2. Anwender geben an, dass sie sich im Winter energiegeladener fühlen, weniger Erkältungen bekommen und sich ihre Knochengesundheit verbessere. Subjektive Erfahrungen ersetzen jedoch keine wissenschaftliche Evidenz. Wenn Du Dich für eine Supplementierung entscheidest, beachte folgende Tipps:
- Lass Deine Werte bestimmen: Vor Beginn der Einnahme ist eine Blutuntersuchung sinnvoll, um den Ausgangswert von 25(OH)D zu kennen. Auch Marker für die Vitamin‑K‑Versorgung (z. B. uncarboxyliertes Osteocalcin) können gemessen werden.
- Einnahmezeitpunkt: Vitamin D3 und K2 sollten zu einer Mahlzeit eingenommen werden, die etwas Fett enthält, damit die fettlöslichen Vitamine optimal aufgenommen werden.
- Kombination mit Magnesium: Magnesium ist ein Cofaktor vieler Enzyme im Vitamin‑D‑Stoffwechsel. Eine ausreichende Magnesiumversorgung kann die Wirkung von Vitamin D3 unterstützen.
- Bewegung: Regelmäßige körperliche Aktivität stimuliert den Knochenstoffwechsel. Krafttraining und Stoßbelastungen (z. B. Treppensteigen) erhöhen die Knochendichte.
- Langfristige Anwendung: Vitamin‑D‑Spiegel bauen sich nach Absetzen der Präparate innerhalb von Wochen ab. Eine langfristige, moderat dosierte Einnahme ist daher effektiver als hohe kurzfristige Dosen.
Die tägliche Einnahme in kleinen Dosen wird von Experten als besser verträglich angesehen als sporadische Hochdosispräparate. Bei Fragen zur Dosierung oder zu Wechselwirkungen solltest Du Deinen Arzt oder Apotheker kontaktieren.
Vitamin D3 und K2 im Kontext des Sports
Für Sportler ist eine stabile Knochengesundheit wesentlich, um Verletzungen vorzubeugen. Vitamin D unterstützt die Muskelkontraktion, die Koordination und die Regeneration nach dem Training, während Vitamin K2 die Knochendichte stabilisiert. Die oben zitierte Studie an deutschen Spitzensportlern zeigte nicht nur einen hohen Anteil unzureichender 25(OH)D‑Spiegel, sondern auch einen positiven Zusammenhang zwischen Vitamin‑D‑Status und Handkraft. Gerade Athleten in Hallensportarten oder mit intensiven Trainingsplänen in der Halle (z. B. Turnen, Schwimmen, Basketball) sind gefährdet, da sie weniger Sonnenlicht erhalten. Eine ausgewogene Ernährung, gezielte Supplementierung und regelmäßige Kontrollen können helfen, den Vitamin‑D‑Status zu optimieren und die Leistungsfähigkeit zu verbessern.
Berichte über die synergetische Wirkung von Vitamin D3 und K2 im Sportbereich sind noch selten. Da die Aktivierung von Osteocalcin und MGP eine Rolle bei der Muskelkraft und dem Energiestoffwechsel spielt, ist jedoch denkbar, dass die Kombination auch die Muskelperformance unterstützt. Diese Hypothese basiert auf physiologischen Mechanismen, ist aber bisher nicht durch randomisierte Sportstudien belegt. Sportler sollten daher die üblichen Ernährungsempfehlungen befolgen und die Einnahme von Ergänzungsmitteln in Abstimmung mit Sportmedizinern planen.
Vitamin D3, K2 und die Psyche
Neben ihren bekannten Effekten auf Knochen und Kreislauf werden Vitamin D3 und K2 zunehmend mit der psychischen Gesundheit in Verbindung gebracht. Vitamin D‑Rezeptoren befinden sich auch im Gehirn; Calcitriol beeinflusst die Synthese neurotropher Faktoren, serotonerger Neurotransmitter und den Schlaf-Wach-Rhythmus. Ein niedriger Vitamin‑D‑Spiegel wird mit Depressionen, saisonaler affektiver Störung und kognitiven Einschränkungen assoziiert. Randomisierte Studien zeigen allerdings inkonsistente Ergebnisse: Einige Untersuchungen berichten über eine leichte Verbesserung depressiver Symptome durch Vitamin‑D‑Supplementierung, andere finden keinen Effekt. Es ist daher noch unklar, inwieweit Vitamin D3 eine direkte Rolle in der Psyche spielt.
Vitamin K2 könnte neuroprotektive Eigenschaften besitzen, da bestimmte Menachinone antioxidativ wirken und die Synthese von Sphingolipiden fördern. Die Evidenzlage ist jedoch spärlich und stammt überwiegend aus In‑vitro‑Studien. Klinische Studien, die die Wirkung von Vitamin K2 auf Stimmung oder kognitive Funktionen untersuchen, stehen noch aus. Dieser Themenbereich bleibt somit ein spannendes Forschungsfeld, erfordert aber Vorsicht bei Interpretationen.
Osteoporose vorbeugen – was Sie beachten sollten
Osteoporose ist eine systemische Skeletterkrankung, die durch eine verringerte Knochenmasse und eine Verschlechterung der mikroarchitektonischen Knochenstruktur gekennzeichnet ist. Sie erhöht das Risiko für Frakturen, insbesondere an Wirbelsäule, Hüfte und Handgelenk. Die Prävention umfasst mehrere Komponenten:
- Kalziumreiche Ernährung: Täglich sollten 1 000–1 200 mg Kalzium über Milchprodukte, grünes Gemüse, Nüsse oder Mineralwasser aufgenommen werden.
- Vitamin D3 und K2: Eine adäquate Zufuhr unterstützt die Kalziumaufnahme und -verwertung. Wie beschrieben, erhöht die Kombination die Knochendichte stärker als die Einzelgaben[24]24}.
- Körperliche Aktivität: Besonders Widerstands- und Krafttraining verbessert die Knochendichte. Bereits 30 Minuten zügiges Gehen pro Tag tragen zur Knochengesundheit bei.
- Verzicht auf Nikotin und mäßiger Alkoholkonsum: Rauchen und übermäßiger Alkoholkonsum fördern den Knochenabbau.
- Hormonersatztherapie: Bei postmenopausalen Frauen kann eine Hormonersatztherapie in Erwägung gezogen werden, sollte aber individuell abgewogen werden. Vitamin D3 und K2 können als unterstützende Maßnahmen dienen.
- Regelmäßige Knochendichtemessung: Bei Risikopersonen (Frauen ab 65 Jahren, Männer ab 70 Jahren, Personen mit chronischem Corticosteroidgebrauch) wird eine Knochendichtemessung (DXA) empfohlen, um Osteopenie frühzeitig zu erkennen.
Nahrungsergänzungsmittel mit Vitamin D3 und K2 können Teil einer ganzheitlichen Osteoporoseprävention sein. Die EFSA erlaubt folgende gesundheitsbezogene Angabe: „Vitamin D trägt zur Erhaltung normaler Knochen bei“ und „Vitamin K trägt zu einer normalen Blutgerinnung und zur Erhaltung normaler Knochen bei“. Aussagen wie „verhindert Osteoporose“ sind nicht zugelassen.
Nachhaltige Lebensweise und Zukunftsperspektiven
Gesundheitliche Versorgung geht über die Einnahme einzelner Vitamine hinaus. Eine ausgewogene Ernährung, regelmäßige Bewegung, Stressmanagement und ausreichend Schlaf sind die Eckpfeiler für ein starkes Immunsystem und gesunde Knochen. Vitamin D3 und K2 können diese Lebensweise ergänzen, indem sie die Kalziumaufnahme optimieren und das Gleichgewicht zwischen Knochen und Gefäßen unterstützen.
Die Forschung zu Vitamin D3 und K2 schreitet schnell voran. Insbesondere die Rolle von Vitamin K2 in der Gefäßgesundheit und die möglichen Vorteile für das Immunsystem werden intensiv untersucht. Künftige randomisierte Langzeitstudien werden zeigen, ob die Beobachtungen aus Tier‑ und Beobachtungsstudien sich in konkrete gesundheitliche Vorteile für den Menschen übersetzen lassen. Bis dahin bleibt die Empfehlung, sich an die geltenden Referenzwerte zu halten und Supplemente als Ergänzung zu einem gesunden Lebensstil zu betrachten.
Fazit
Vitamin D3 und Vitamin K2 sind zwei essenzielle fettlösliche Vitamine, deren Zusammenarbeit für die Knochengesundheit entscheidend ist. Vitamin D3 sorgt dafür, dass Kalzium aus dem Darm aufgenommen und zu den Knochen transportiert wird; Vitamin K2 aktiviert Proteine wie Osteocalcin und MGP, die Kalzium in die Knochen einbauen und vor Ablagerungen in den Gefäßen schützen. Studien zeigen, dass die Kombination beider Vitamine die Knochendichte verbessert, die Heilung nach Knochenoperationen unterstützt und möglicherweise zur kardiovaskulären Gesundheit beiträgt[25][26]. Gleichzeitig gibt es Hinweise auf immunmodulatorische Effekte und einen Einfluss auf die Muskelkraft[27][28].
Trotz vielversprechender Ergebnisse bleiben einige Fragen offen. Die optimale Dosierung, die Dauer der Einnahme und die langfristigen Effekte auf verschiedene Bevölkerungsgruppen müssen weiter erforscht werden. Eine Überdosierung kann unerwünschte Nebenwirkungen verursachen, weshalb eine Supplementierung individuell angepasst werden sollte. Vor allem ist zu betonen, dass Vitamin D3 und K2 keine Medikamente sind und nicht zur Behandlung von Erkrankungen eingesetzt werden dürfen. Sie tragen im Rahmen eines gesunden Lebensstils zur Erhaltung normaler Knochen, einer normalen Muskelfunktion und einer normalen Blutgerinnung bei, wie die EU‑Health‑Claims‑Verordnung erlaubt.
Die Kombination aus Vitamin D3 und K2 kann, eingebettet in eine ausgewogene Ernährung und regelmäßige Bewegung, ein wertvoller Baustein für starke Knochen, ein gesundes Immunsystem und eine insgesamt bessere Lebensqualität sein.
- [1] Kühn, G., & Müller, H. (2017). The synergistic interplay between Vitamins D and K for bone and cardiovascular health. International Journal of Endocrinology, 2017, Article ID 7453471. DOI: 10.1155/2017/7453471.
- [2] Tayel, S. et al. (2024). Investigating the effects and mechanisms of combined vitamin D and K supplementation in postmenopausal women. Nutrients, 16(2), 1–20. DOI: 10.3390/nu16020549.
- [3] Hussain, M., Alam, F., & Yousaf, M. (2022). Studies on the synergistic interplay of Vitamin D and K for improving bone and cardiovascular health: a systematic review. Current Research in Nutrition and Food Science, 10(2), 1–15. DOI: 10.12944/CRNFSJ.10.2.11.
- [4] Ma, M. L., et al. (2022). Efficacy of vitamin K2 in the prevention and treatment of postmenopausal osteoporosis: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. Frontiers in Public Health, 10, 979649. DOI: 10.3389/fpubh.2022.979649.
- [5] Vermeer, C., & Knapen, M. H. (2024). The importance of vitamin K and the combination of vitamins K and D for calcium metabolism and bone health. Nutrients, 16(3), 1–29. DOI: 10.3390/nu16030659.
- [6] Hu, L., Ji, J., Li, D., Meng, J., & Yu, B. (2021). The combined effect of vitamin K and calcium on bone mineral density in humans: a meta-analysis of randomized controlled trials. Journal of Orthopaedic Surgery and Research, 16(1), 592. DOI: 10.1186/s13018-021-02728-4.
- [7] Aranow, C. (2023). Immunomodulatory actions of vitamin D in various immune-related disorders. Frontiers in Immunology, 14, 1053878. DOI: 10.3389/fimmu.2023.1053878.
- [8] Peng, L., et al. (2024). Effects of vitamin D supplementation on muscle strength in middle-aged and elderly individuals: a retrospective propensity score–matched study. Frontiers in Nutrition, 11, 1175543. DOI: 10.3389/fnut.2024.1175543.
- [9] Simon, L. S., et al. (2022). Vitamin D supplementation and autoimmune disease incidence in the VITAL trial: a post-trial follow-up study. Arthritis & Rheumatology, 74(12), 2019–2028. DOI: 10.1002/art.41991.
- [10] Hariri, E., et al. (2021). Vitamin K2—a neglected player in cardiovascular health: a narrative review. Open Heart, 8(2), e001715. DOI: 10.1136/openhrt-2021-001715.
- [11] Huang, Z. B., et al. (2020). The combination effect of vitamin K and vitamin D on human bone quality: a meta-analysis of randomized controlled trials. Food & Function, 11(4), 3280–3297. DOI: 10.1039/c9fo03063h.
- [12] Wang, Y., et al. (2025). Combined vitamin K2 and D3 therapy improves endoscopic fusion outcomes in osteoporotic lumbar degenerative disease: a prospective study. Scientific Reports, 15, 15422. DOI: 10.1038/s41598-025-99922-9.
- [13] Je, S. H., Joo, N. S., Choi, B., et al. (2011). Vitamin K supplement along with vitamin D and calcium reduced serum concentration of undercarboxylated osteocalcin while increasing bone mineral density in Korean postmenopausal women over sixty‑years‑old. Journal of Korean Medical Science, 26(8), 1093–1098. DOI: 10.3346/jkms.2011.26.8.1093.
- [14] Rønn, S. H., Harsløf, T., Oei, L., Pedersen, S. B., & Langdahl, B. L. (2021). The effect of vitamin MK‑7 on bone mineral density and microarchitecture in postmenopausal women with osteopenia: a three‑year randomized, placebo‑controlled clinical trial. Osteoporosis International, 32(1), 185–191. DOI: 10.1007/s00198-020-05638-z.
- [15] Hacker, S., et al. (2025). Vitamin D status and its determinants in German elite athletes. European Journal of Applied Physiology, 125(6), 1549–1561. DOI: 10.1007/s00421-024-05699-6.